Fresko:
Geschichte und Maltechnik  Automatische übersetzen
Automatische übersetzen
Fresko ist die älteste Form der Monumentalmalerei und wird mit wasserbasierten Farben auf frischem, feuchtem Putz ausgeführt. Der Name leitet sich vom italienischen „fresco“ – „frisch“ ab. Nach dem Trocknen bildet der im Putz enthaltene Kalk einen dünnen, transparenten Kalzitfilm, der das Bild haltbar macht. Die Freskotechnik existiert seit mehreren Jahrtausenden und hat sich in verschiedenen Regionen der Welt weiterentwickelt. Sie hat der Menschheit unschätzbare Kunstwerke hinterlassen.

2 Antike Freskomalerei
3 Fresko in der mittelalterlichen Kunst
4 Der Aufstieg des Freskos in der Renaissance
5 Technische Aspekte der Freskenherstellung
6 Fresko im Kontext der Weltkunst
7 Konservierung und Restaurierung von Fresken
8 Plinius der Ältere über Malerei und Fresken
9 Technische Neuerungen und die Entwicklung des Freskos
Die Ursprünge der Freskomalerei
Das genaue Datum des Auftretens von Fresken ist unbekannt, aber archäologische Funde deuten darauf hin, dass die Freskenmalerei bereits im 2. Jahrtausend v. Chr., während der ägäischen Kultur, weit verbreitet war. Die minoische Zivilisation, die auf der Insel Kreta existierte, hinterließ eindrucksvolle Beispiele der Wandmalerei mit Bildern von Meeresfauna, Ritualszenen und alltäglichen Episoden.
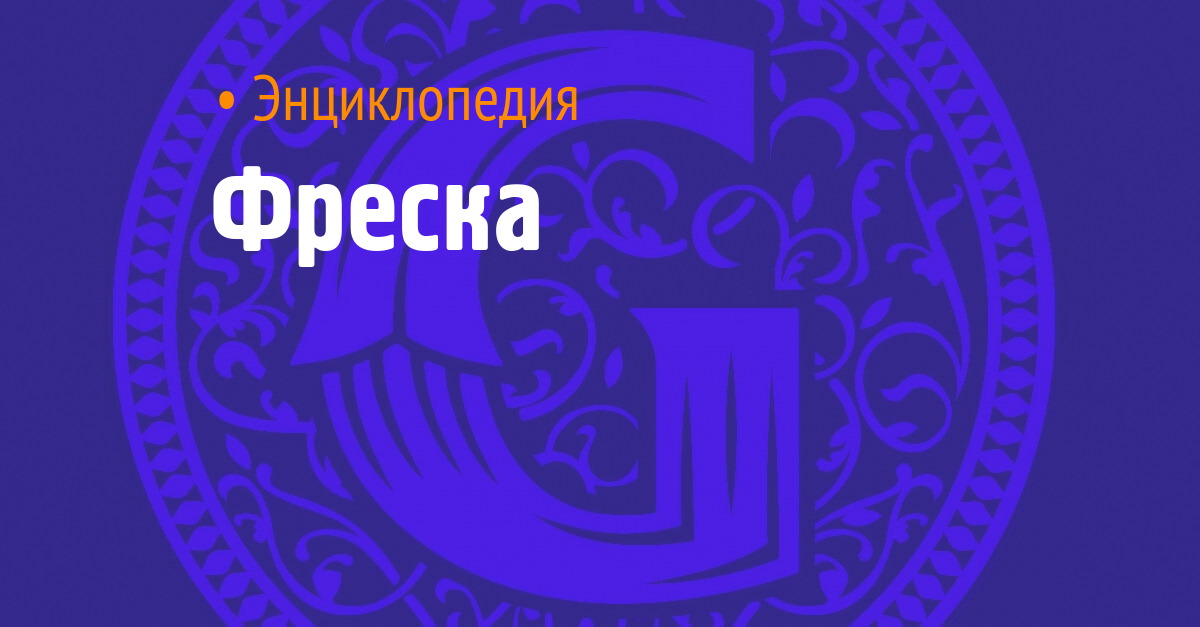
Fresko-Malerei
Was ist Freskomalerei? Merkmale Der künstlerische Begriff Fresko (italienisch „frisch“) bezeichnet eine Methode der Malerei, bei der Farbpigmente nur mit Wasser (ohne Bindemittel) gemischt und dann direkt auf frisch aufgetragenen Kalkputz (grundierte Oberfläche) aufgetragen werden.
Fresken aus dem Palast von Knossos auf Kreta, wie die „Damen in Blau“ und „Die Pariserin“, zeichnen sich durch leuchtende Farben und ausdrucksstarke Bilder aus. Die Minoer verwendeten eine dem Alsecco ähnliche Technik, bei der Leim oder Kasein als Bindemittel verwendet wurde.
Auch das alte Ägypten, Assyrien, Babylonien und Phönizien hatten ihre eigenen Traditionen der Wandmalerei mit Kalk. Kalkmischungen wurden nicht nur für künstlerische Zwecke verwendet, sondern auch zur Herstellung feuchtigkeitsbeständiger Kitte beim Bau von Aquädukten und Wasserbauwerken.
In Wohn- und Palastgebäuden der Ägäiskultur wurden hochwertige Kalkmischungen verwendet, die als Untergrund für Wandmalereien dienten. Allerdings werden auch sie bedingt als Fresken „auf nassem Untergrund“ klassifiziert, da es erhebliche technologische Unterschiede zur später entwickelten klassischen Freskotechnik gibt.
Antike Freskomalerei
In der Antike erreichte die Freskomalerei ein hohes Niveau. Die Verfügbarkeit von Materialien (Kalk, Sand, farbige Mineralien), die relative Einfachheit der Technik und die Haltbarkeit der Werke bestimmten die Beliebtheit der Freskomalerei im antiken Griechenland und Rom.
Besonders wertvoll für das Studium der antiken Freskenmalerei sind die Funde in den Städten, die 79 n. Chr. durch den Ausbruch des Vesuvs verschüttet wurden – Pompeji, Herculaneum und die umliegenden Villen. Dank der Vulkanasche, die diese Städte konservierte, sind bis heute zahlreiche Fresken mit erhaltenen leuchtenden Farben erhalten geblieben.
Pompeji wurde Anfang des 17. Jahrhunderts zufällig beim Bau eines Aquädukts entdeckt. Die Stadt befreite sich allmählich von der vulkanischen Hülle und die Welt sah einzigartige Beispiele antiker Freskenmalerei. Es ist paradox, aber der Ausbruch, der die Stadt zerstörte, bewahrte sie jahrhundertelang und brachte ihr weltweiten Ruhm.
Die Fresken von Pompeji verblüffen durch ihre Erhaltung und die Leuchtkraft ihrer Farben auch nach Jahrtausenden. Forschern zufolge verwendeten lokale Künstler eine spezielle Technik, deren Geheimnis bis heute nicht vollständig gelüftet ist. Die Schlichtheit und gleichzeitig Virtuosität der Fresken verblüffte Renoir selbst, der Pompeji 1881 besuchte.
Römische Fresken wurden nicht nur zum ästhetischen Vergnügen geschaffen, sondern hatten auch eine praktische Funktion – sie erweiterten den Raum optisch und machten Innenräume heller und luftiger. Bei begrenztem Tageslicht war dies besonders wichtig.
Vier Stile der pompejanischen Malerei
Forscher identifizieren vier Hauptstile der pompejanischen Malerei, die die Entwicklung der Freskotechnik und der künstlerischen Vorlieben der römischen Gesellschaft widerspiegeln:
- Der erste Stil (2. - 1. Jahrhundert v. Chr.) ist Intarsienkunst, die Wandverkleidungen mit farbigem Marmor imitiert. Charakteristisch sind geometrische Formen und leuchtende lokale Farben.
- Der zweite Stil (1. Jahrhundert v. Chr.) ist architektonisch perspektivisch und erzeugt durch die perspektivische Darstellung architektonischer Elemente die Illusion von Raum. Die Wände scheinen sich auseinanderzubewegen und geben den Blick auf Landschaften, Städte und Heiligtümer frei.
- Der dritte Stil (Ende des 1. Jahrhunderts v. Chr. – Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr.) ist ornamental oder Kandelaber. Die Wand wird als eine Ebene wahrgenommen, die mit eleganten Ornamenten, Miniaturlandschaften und mythologischen Szenen verziert ist.
- Der vierte Stil (Mitte bis Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr.) ist fantastisch oder illusionistisch. Er kombiniert Elemente früherer Stile mit fantastischen architektonischen Formen und schafft so komplexe dekorative Kompositionen.
Fresko in der mittelalterlichen Kunst
Im Mittelalter entwickelte sich die Freskomalerei zur wichtigsten Form monumentaler Kunst in der christlichen Welt. In Byzanz erlangte die Freskomalerei besondere Bedeutung, insbesondere während des Niedergangs des Reiches, als die Herstellung teurer Mosaike wirtschaftlich schwierig wurde.
Byzantinische Fresken zeichneten sich durch ihren strengen kanonischen Charakter, die Unterordnung des Bildes unter Architektur und theologische Ideen aus. Sie stellten religiöse Szenen dar und vermittelten die spirituellen und kulturellen Werte ihrer Zeit. Bemerkenswerte Beispiele sind die Fresken der Evangelistria-Kirche in Geraki und der Christi-Erlöser-Kirche auf den Feldern.
Als Mittel zur visuellen Vermittlung religiöser Themen wurden Fresken zu einem Spiegelbild des kulturellen Kontexts der byzantinischen Gesellschaft. Sie erfüllten eine wichtige didaktische Funktion, indem sie der des Lesens und Schreibens unkundigen Bevölkerung biblische Themen anschaulich darstellten.
Fresken der alten Rus
Im Alten Russland entstand die monumentale Malerei mit der Annahme des Christentums unter den Fürsten Wladimir (980–1015) und Jaroslaw dem Weisen (1019–1054). Im Laufe der Jahrhunderte übernahmen russische Meister die Kunst der „Griechen“ (wie die griechisch sprechenden Byzantiner genannt wurden).
Die Wandmalerei im Alten Russland war überwiegend eine Mischtechnik – die Malerei mit Wasserfarben auf nassem Putz wurde durch die Tempera-Leim-Technik mit verschiedenen Bindemitteln (Ei-, Tier- und Pflanzenleime) ergänzt. Hintergründe und Obermalereien wurden oft in der Alsecco-Technik ausgeführt.
Um die Kiewer Kirchen mit Mosaiken zu schmücken, wurde eine spezielle Werkstatt eingerichtet, in der Smalten in verschiedenen Farben hergestellt wurden. Die Kompositionen in der Kuppel und der Apsis wurden in der Mosaiktechnik ausgeführt, da diese die teuerste und komplexeste Technik ist. Der Rest des Tempels wurde mit Fresken bemalt.
Die Fresken der Sophienkathedrale in Kiew, die während der Zeit Jaroslaws des Weisen entstanden, zählen zu den wertvollsten Denkmälern der altrussischen Kunst. Im Zenit der zentralen Kuppel befand sich in einem Medaillon ein riesiges Halbbild Christi, umgeben von vier Erzengeln.
Der Aufstieg des Freskos in der Renaissance
Im Europa der Renaissance wurde die Beherrschung der Wandmalerei zu einem der wichtigsten Maßstäbe für das Können eines Künstlers. In Italien erreichte die Freskenmalerei in dieser Zeit ihre höchste Entwicklung.
Während der Frührenaissance verbreitete sich die Freskenmalerei enorm. Die meisten italienischen Künstler dieser Zeit waren Freskenmaler. Die von Giotto di Bondone initiierten Reformen der Freskenmalerei wurden zu einer Schule für Generationen italienischer Künstler.
Klöster wetteiferten darum, berühmte Künstler einzuladen. Meisterwerke der Fresken bedeckten die Wände sowohl alter, noch gotischer Gebäude als auch neuer Gebäude in den Provinzen und Kunstzentren. Fresken schmückten Kirchen, Paläste, Kapellen und öffentliche Gebäude, sowohl Fassaden als auch Innenräume.
Die Themen der Fresken waren vielfältig: Szenen aus dem Alten Testament (zum Beispiel die Erschaffung Adams), Episoden aus dem Leben und der Passion Christi (Verkündigung, Abendmahl, Kreuzigung), Allegorien (Allegorie der weisen Herrschaft), mythische Figuren (Herkules, die Sibyllen), Schlachtenszenen und historische Ereignisse.
Während der Hochrenaissance wirkten so große Freskomeister wie Raffael (Vatikan-Strophen) und Michelangelo (Gemälde der Sixtinischen Kapelle). Die Freskotechnik erforderte vom Künstler eine sichere Hand, schnelles Arbeiten und eine klare Vorstellung von der Komposition. An einem Tag musste der Meister einen bestimmten Abschnitt der Wand bemalen, bevor der Putz trocknete.
Der Begriff „buon fresco“ oder „reines Fresko“ tauchte erstmals in einer Abhandlung des italienischen Künstlers Cennino Cennini (1437) auf, in der er eine Technik zum Malen auf frischem Putz beschrieb. Diese Technik unterschied sich vom früheren al secco (Malen auf trockenem Putz) und wurde in der Renaissance zur wichtigsten Methode für die Schaffung monumentaler Werke.
Einer der wichtigsten Aspekte bei der Entstehung eines Freskos in der Renaissance war die Aufteilung des Werks in Giornata, Abschnitte, die der Künstler an einem einzigen Tag malen konnte. In Masaccios berühmtem Fresko „Heilige Dreifaltigkeit“ sind 24 Giornata erkennbar. Betrachtet man das Fresko von oben nach unten, erkennt man die verschiedenen Abschnitte, die an einem einzigen Tag gemalt wurden.
Technische Aspekte der Freskenherstellung
Arten der Freskotechnik
Es gibt drei Hauptarten der Freskotechnik, von denen jede ihre eigenen Merkmale und Anwendungen hat:
- Buon Fresco (italienisch: buon fresco – echtes Fresko) ist die gebräuchlichste Methode. Dabei werden Pigmente nur mit Wasser gemischt, ohne Bindemittel. Die Farben werden auf eine dünne Schicht feuchten, frischen Kalkputzes (Intonaco) aufgetragen. Das Pigment wird vom Putz absorbiert und wird beim Trocknen zu einem Bestandteil davon, was die Haltbarkeit des Gemäldes gewährleistet.
- Al secco (ital.: al secco – auf dem Trockenen) ist Malerei auf trockenem Putz mit Bindemittel. Im Gegensatz zur Freskomalerei benötigt sie ein Bindemittel (zum Beispiel Eitempera, Leim oder Öl), um das Pigment an der Wand zu befestigen. Diese Technik wurde beispielsweise in Leonardo da Vincis „Das letzte Abendmahl“ verwendet. Al secco bietet einen Zeitgewinn, da an einem Arbeitstag eine größere Fläche bemalt werden kann als bei der Freskomalerei, ist aber eine weniger haltbare Technik.
- Mezzofresko (ital.: mezzo fresco – Halbfresko) ist Malerei auf getrocknetem, aber noch nicht vollständig durchgetrocknetem Putz. Das Pigment dringt nur teilweise in den Putz ein. Im 17. Jahrhundert hatte diese Technik das Buonfresko an Wänden und Decken weitgehend ersetzt.
Alsecco wird auch Kasein- und Silikatmalerei auf getrocknetem Putz genannt. Es wird für Arbeiten an Innen- und Außenflächen von Gebäuden verwendet. Die Technik ermöglicht nachträgliche Korrekturen mit Tempera und Abspülen mit klarem Wasser.
Materialien zum Erstellen eines Freskos
Zur Herstellung eines Freskos werden traditionell folgende Materialien verwendet:
- Hochwertiger Kalk (CL 90 oder höher gemäß der europäischen Norm EN 459-1)
- Sand unterschiedlicher Körnung (von grob für die unteren Schichten bis fein für die letzte Schicht)
- Natürliche, kalkbeständige Pigmente
- Wasser zum Mischen von Lösungen und Farben
- Werkzeuge: Pinsel, Spachtel, Kellen, Lineale, Lote
Die Freskopalette ist eher zurückhaltend. Es werden Farben verwendet, die keine chemischen Verbindungen mit Kalk eingehen. Traditionell wurden natürliche Erdpigmente (Ocker, Umbra) sowie Mars, Blau und Grünkobalt verwendet. Kupferfarben wurden aufgrund ihrer chemischen Aktivität seltener verwendet.
Der Entstehungsprozess eines Freskos
Oberflächenvorbereitung
Der erste Schritt bei der Erstellung eines Freskos ist die Vorbereitung der Wand. Zunächst wird eine Schicht „Gobetis“ aufgetragen – ein rauer Putz zum Nivellieren der Oberfläche. Frühestens eine Woche später wird dann eine Schicht „Arriccio“ aufgetragen – eine zweite, etwa 1 cm dicke Putzschicht, bestehend aus zwei Teilen Sand und einem Teil Luftkalk.
Der Arrico dient dazu, die Feuchtigkeit für die nachfolgende Intonaco-Schicht zu erhalten, sodass die Malzeit möglichst lange gehalten werden kann. Vor dem Auftragen des Arrico wird der Gobetis mehrere Tage lang großzügig mit Wasser befeuchtet. Nach dem Auftragen des Arrico wird seine Oberfläche aufgeraut, damit die nächste Schicht besser haftet.
Erstellen einer vorbereitenden Zeichnung
Auf der vorbereiteten Oberfläche des Arrico erstellt der Künstler eine vorbereitende Zeichnung – Sinopia. Der Name leitet sich von der roten Farbe ab, die aus Eisenoxid hergestellt wird, das in der Nähe der Stadt Sinop am Schwarzen Meer abgebaut wurde. Es ist das einzige rote Pigment, das den Künstlern der Antike bekannt war.
Die Sinopia wurde von italienischen Freskenmalern bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts häufig verwendet. Dann wurde sie durch die Technik ersetzt, bei der eine vorbereitende Zeichnung von „Transparentpapier“ mit Hilfe eines Pulvers auf nassen Putz gedrückt wird. Kohlepulver wurde durch Einstiche auf die Wand aufgetragen und hinterließ einen gepunkteten Umriss.
Anwendung von Intonaco und Malerei
Die letzte Putzschicht ist Intonaco – eine dünne Schicht (5–7 mm), auf die die Farbe aufgetragen wird. Intonaco wird in kleinen Abschnitten – Giornata – aufgetragen, die der Künstler an einem Tag malen kann, während der Putz noch feucht ist.
Giornata (italienisch: giornata, „Tagesarbeit“) ist ein wichtiger Begriff in der Buon-Fresco-Technik. Er beschreibt, wie viel Malerei an einem Arbeitstag erledigt werden kann. Diese Menge basiert auf den bisherigen Erfahrungen des Künstlers und berücksichtigt, wie viel er in den Stunden malen kann, in denen der Putz feucht bleibt und das Pigment an der Wand haften kann.
Bei der Buon-Fresco-Technik ist es entscheidend zu wissen, wie viel an einem Tag gemalt werden kann. Normalerweise wird der Putz so aufgetragen, dass er den Umrissen der Figur oder des Objekts im Gemälde entspricht, sodass die Tagesabschnitte nicht auffallen.
Nach dem Auftragen des Intonaco beginnt der Künstler sofort mit dem Malen. Dabei verwendet er ausschließlich mit Wasser vermischte Pigmente. Die Arbeit erfordert Schnelligkeit und Präzision, da Korrekturen nur durch das Entfernen des nicht gelungenen Gipsabschnitts und das Auftragen einer neuen Schicht möglich sind.
Nach Feierabend wird der überschüssige Gips abgekratzt, um ein Austrocknen zu verhindern. So kann der Künstler am nächsten Morgen mit frischem, feuchtem Gips zum Bemalen beginnen.
Beim Trocknen reagiert der Kalk im Putz mit Kohlendioxid aus der Luft und bildet Calciumcarbonat. Dadurch entsteht eine starke kristalline Struktur, die die Pigmente bindet. Dieser Prozess wird als Karbonatisierung bezeichnet und sorgt für die Langlebigkeit des Freskos.
Abschlussarbeiten
Nachdem das Hauptgemälde getrocknet war, konnte der Künstler mithilfe der Alsecco-Technik einige Ergänzungen vornehmen. Details wie kleine Ornamente oder Glanzlichter wurden oft in Tempera auf das bereits trockene Fresko aufgetragen. Dies ermöglichte eine größere Detailgenauigkeit und die Verwendung von Farben, die in der alkalischen Umgebung des frischen Kalkputzes instabil waren.
Fresko im Kontext der Weltkunst
Die Freskenmalerei ist seit Jahrtausenden eine der wichtigsten Formen der Monumentalkunst. Sie schmückte die Wände von Tempeln, Palästen und öffentlichen Gebäuden und vermittelte religiöse, historische und kulturelle Themen aus verschiedenen Epochen.
Die soziokulturelle Bedeutung des Freskos
Im antiken Rom dienten Fresken nicht nur einer dekorativen, sondern auch einer sozialen Funktion: Sie demonstrierten den Status und Geschmack des Hausbesitzers. Für die Römer war Kunst in erster Linie ein Mittel zur Erziehung des idealen römischen Bürgers.
Die Aktivitäten von Julius Caesar, Octavian Augustus und Marcus Vipsanius Agrippa können zur Untersuchung der Entstehung protomusealer Formen im Römischen Reich herangezogen werden. Bei der Analyse der Unterschiede in der Kunstwahrnehmung der Griechen und Römer kommen Forscher zu dem Schluss, dass für letztere die ästhetische Funktion der Kunst nicht von vorrangiger Bedeutung war.
In der christlichen Kunst wurde das Fresko zu einer beliebten Methode, die Innen- und (seltener) Außenwände einer Steinkirche zu schmücken. Es erfüllte eine wichtige didaktische Funktion und stellte biblische Geschichten für die Analphabeten anschaulich dar – es war eine Art „Bibel für Analphabeten“.
Während der Renaissance erlangte die Wanddekoration mit Fresken in den Innenräumen von Renaissancepalästen eine besondere Bedeutung. Die Pracht der Räume wurde nicht durch kostbare Möbel, sondern durch die dekorative Gestaltung von Wänden, Decken und Böden erreicht. Fresken wurden zu einem integralen Bestandteil des architektonischen Raumes und betonten und verstärkten dessen ästhetische Wirkung.
Freskomalerei in der Kunst verschiedener Regionen
Neben der europäischen Tradition entwickelte sich die Freskenmalerei auch in anderen Kulturen. In Indien beispielsweise sind in den Höhlentempeln von Ajanta und Ellora antike Fresken erhalten, die zwischen dem 2. Jahrhundert v. Chr. und dem 7. Jahrhundert n. Chr. entstanden. Diese Gemälde, die in einer dem Alsecco ähnlichen Technik gefertigt wurden, zeigen Szenen aus dem Leben Buddhas und buddhistische Gleichnisse.
Auch in der mittelalterlichen armenischen Kunst nahm die Freskenmalerei einen wichtigen Platz ein. Trotz der fragmentarischen Erhaltung des künstlerischen Materials und der irrigen Vorstellung von der ablehnenden Haltung der armenischen Kirche gegenüber Bildern zeigt die Forschung eine reiche Tradition der Monumentalmalerei in Armenien.
Dank einer eingehenden Untersuchung sowohl der Fresken selbst als auch mittelalterlicher schriftlicher Quellen konnten Wissenschaftler die wichtigsten Entwicklungswege der armenischen Wandmalerei aufzeigen, künstlerische Trends und nationale Besonderheiten identifizieren und die Merkmale dekorativer Programme und ikonografischer Varianten bestimmen.
Auch in der modernen Welt ist das Interesse an der traditionellen Freskotechnik ungebrochen. Viele Künstler wenden sich dieser alten Kunst zu und finden darin neue Möglichkeiten zur kreativen Selbstdarstellung. Freskenmalerei in einem modernen Interieur, ob privat oder öffentlich, kann eine einzigartige Atmosphäre schaffen und die Individualität des Raumes unterstreichen.
Konservierung und Restaurierung von Fresken
Die Konservierung von Fresken ist aufgrund ihrer Anfälligkeit gegenüber Umwelteinflüssen eine schwierige Aufgabe. Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen, Luftverschmutzung und mechanische Beschädigungen können diesen Kunstwerken irreparablen Schaden zufügen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Methoden zur sukzessiven Trennung von Schichten monumentaler Malerei (Stacco und Strappo) entwickelt, die es ermöglichten, viele Fresken zu retten, die von der Zerstörung bedroht waren. Diese Methoden ermöglichten auch die Entdeckung und Untersuchung von Sinopien, was das Verständnis des Entstehungsprozesses von Fresken vertiefte.
Bei der Stacco-Methode wird die Farbschicht zusammen mit einer dünnen Putzschicht entfernt, während bei der Strappo-Methode nur die Farbschicht entfernt wird. Diese Technologien haben es ermöglicht, Fresken von den Wänden verfallener Gebäude in Museen zu überführen und ihnen angemessene Lagerbedingungen zu bieten.
Moderne Methoden der Freskenrestaurierung basieren auf dem Prinzip der minimalen Eingriffe und der Reversibilität. Restauratoren sind bestrebt, die Authentizität des Werks zu bewahren, indem sie originalgetreue Materialien verwenden und alle Arbeitsschritte dokumentieren.
Ein wichtiger Aspekt der Freskokonservierung ist die Schaffung optimaler Umgebungsbedingungen. Die Kontrolle von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Beleuchtung trägt dazu bei, den Abbau der Farbschicht und des Putzgrundes zu verlangsamen.
Plinius der Ältere über Malerei und Fresken
Eine der wichtigsten Quellen zur Geschichte der antiken Malerei ist das Werk des römischen Enzyklopädisten Plinius des Älteren, die Naturgeschichte, insbesondere das 35. Buch. Plinius untersucht die Geschichte der Malerei, erwähnt verschiedene Techniken und Methoden des künstlerischen Handwerks und denkt auch über das pädagogische Potenzial der Kunst nach.
Plinius der Ältere beschreibt die Ursprünge der Malerei, erwähnt den Begriff Monochromatos (monochrome Malerei) und seinen Zusammenhang mit der Geschichte der antiken griechischen Malerei. Er liefert auch wertvolle Informationen über die antiken Kunstschulen, insbesondere die sikyonische Schule.
Plinius widmet dem Künstler Pamphilus als Begründer der Malereilehre an allen antiken griechischen Schulen große Aufmerksamkeit. Er analysiert auch die Unterschiede in der Kunstauffassung der Griechen und Römer, was modernen Forschern hilft, den Kontext der Entwicklung der Freskenmalerei in der Antike besser zu verstehen.
Technische Neuerungen und die Entwicklung des Freskos
Die Freskotechnik blieb nicht unverändert – sie entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte weiter und passte sich neuen ästhetischen Anforderungen und technologischen Möglichkeiten an. In verschiedenen Regionen der Welt entwickelten Meister ihre eigenen Variationen der klassischen Technik und bereicherten so das künstlerische Erbe der Welt.
Im Alten Russland beispielsweise war die Wandmalerei überwiegend in Mischtechnik gehalten – die Malerei mit Wasserfarben auf nassem Putz wurde durch die Tempera-Leim-Technik mit verschiedenen Bindemitteln (Ei-, Tier- und Pflanzenleime) ergänzt. Hintergründe und Obermalereien wurden oft in der Alsecco-Technik ausgeführt.
Während der Renaissance perfektionierten italienische Meister die Buon-Fresco-Technik und erreichten eine unglaubliche Meisterschaft in der Darstellung von Volumen, Raum und Licht-Luft-Atmosphäre. Sie entwickelten ein komplexes System aus vorbereitenden Zeichnungen und Kartons, das ihnen eine präzise Planung der Komposition ermöglichte und bei der Arbeit auf nassem Putz Zeit sparte.
Mit der Entwicklung von Chemie und Technologie im 19. und 20. Jahrhundert erschienen neue Pigmente und Bindemittel, die die Palette der Fresken erweiterten. Meister bevorzugten jedoch oft die Arbeit mit traditionellen Materialien, da sie deren bewährte Qualitäten und ästhetische Möglichkeiten schätzten.
In der zeitgenössischen Kunst lebt das Fresko weiter und erhält neue Formen und Bedeutungen. Künstler experimentieren mit Techniken und kombinieren traditionelle Methoden mit modernen Materialien und Ansätzen, wodurch diese alte Kunst auch im 21. Jahrhundert relevant bleibt.
Fresko ist eine der ältesten und langlebigsten Techniken der Monumentalmalerei. Sie hat einen langen Weg zurückgelegt: von primitiven Bildern antiker Zivilisationen über Meisterwerke der Hochrenaissance bis hin zu modernen experimentellen Werken. Die technischen Besonderheiten des Freskos, die vom Künstler Schnelligkeit, Präzision und ein tiefes Verständnis der Materialien erfordern, machten es zu einer besonderen Kunstform, die nur wahren Meistern zugänglich war.
Fresken erfüllen seit Jahrtausenden nicht nur ästhetische, sondern auch wichtige soziale, religiöse und didaktische Funktionen. Sie spiegeln das Weltbild der jeweiligen Epoche wider, dienen der Wissens- und Wertevermittlung und prägen die visuelle Kultur der Gesellschaft.
Moderne Forschungs- und Restaurierungsarbeiten ermöglichen es uns, die technischen und künstlerischen Aspekte der Freskenmalerei besser zu verstehen und dieses unschätzbare Weltkulturerbe für zukünftige Generationen zu bewahren. Das anhaltende Interesse von Künstlern und Öffentlichkeit an dieser alten Technik zeugt von ihrem anhaltenden Wert und ihrer Relevanz in der Welt der Kunst.
Adblock bitte ausschalten!